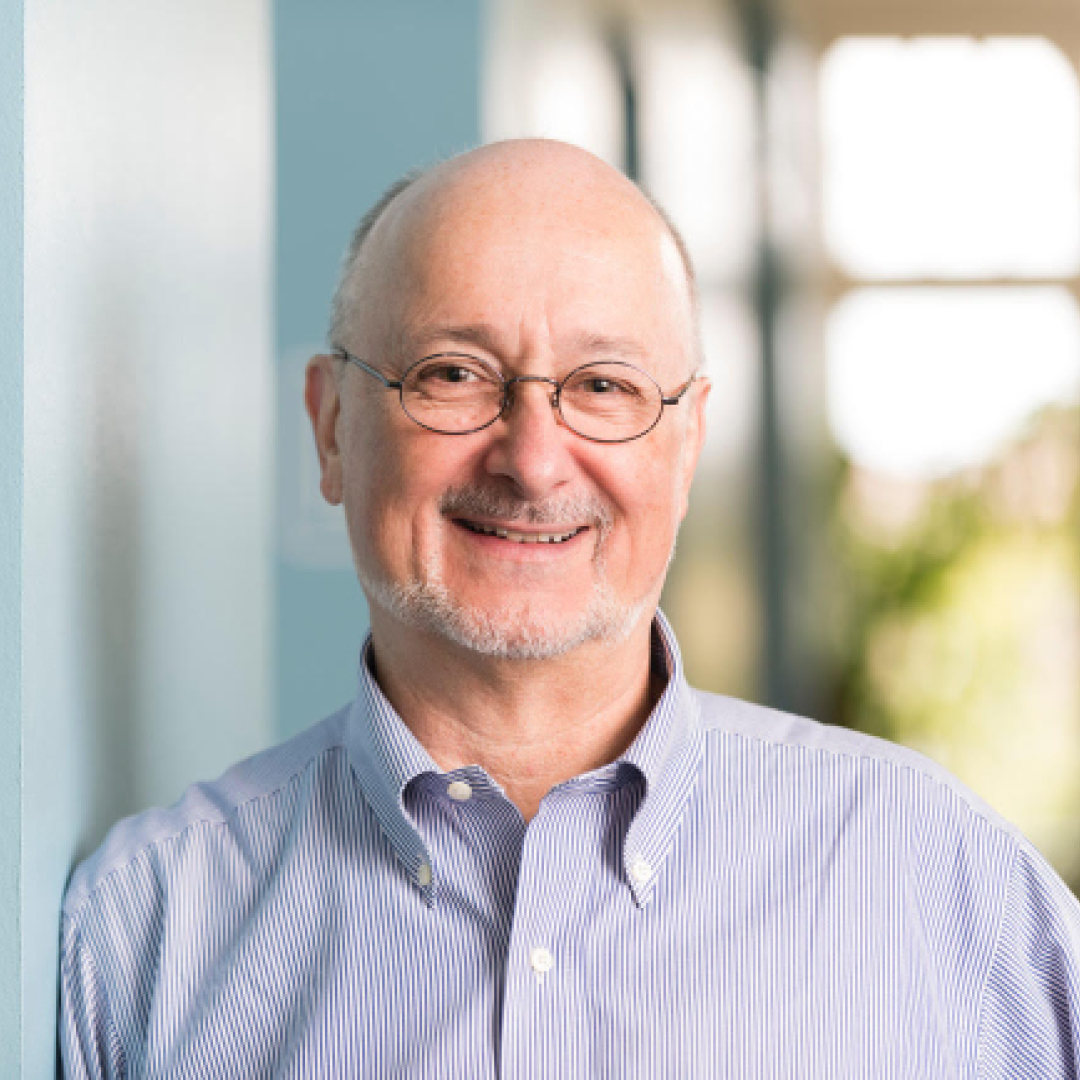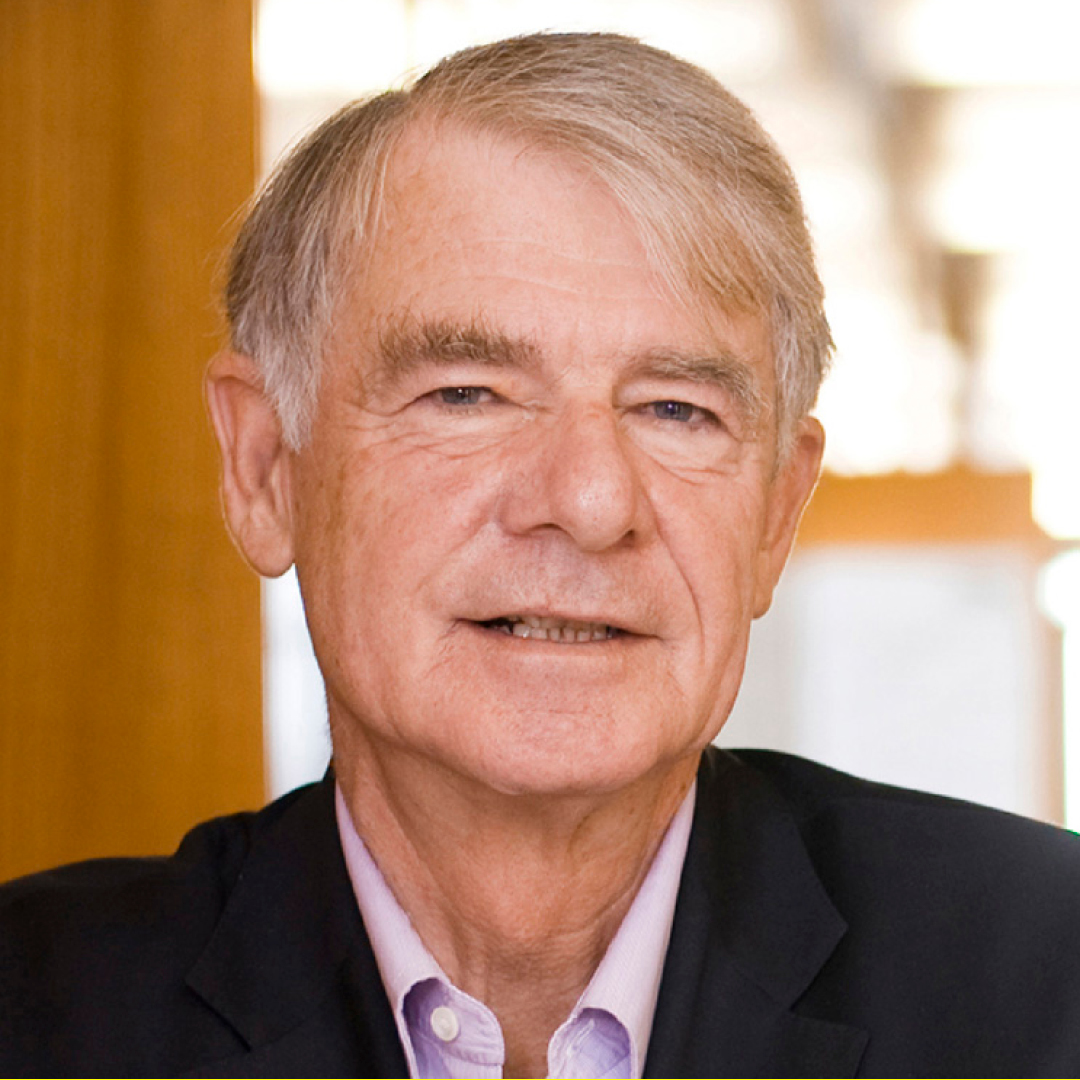Das Archiv der Zukunft stellt neugierige Fragen zu Innovation und Technik - und ausgewählte Experten antworten. Wir veröffentlichen in jeder Ausgabe unseres Newsletters spannende Einblicke zu den relevantesten Zukunftsthemen. Hier sind alle Expertenantworten auf die überraschenden Fragen zum Nachlesen versammelt.
Prof. Dr. Alexander Waibel ist ein führender Wissenschaftler auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und Mitglied der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina. Eines seiner KI-Projekte, eine simultan übersetzende Software, wurde 2021 vom Videokonferenz-Anbieter „Zoom“ übernommen.
Herr Prof. Waibel, können Roboter träumen?
* "Wussten Sie, dass es den Satz ‚Ich muss drüber schlafen‘ in fast allen Kulturen gibt? Das hat einen Grund: Wir wissen, dass wir im Träumen Probleme lösen und verarbeiten – auch, wenn uns nicht ganz klar ist, wie das funktioniert. In der sogenannten Rapid Eye Movement-Phase des Schlafs wird jede externe, physiologische Ankopplung des Gehirns ausgeschaltet. Während von Außen nichts eindringen kann, läuft das emotionale Zentrum des Gehirns auf Hochtouren. Das Träumen ist also ein interner Prozess. Da KI heute genauso wie das menschliche Gehirn aus neuronalen Netzen besteht, die trainiert werden, könnte man annehmen, dass auch die künstliche Intelligenz träumen kann. Bisher ist das aber nicht der Fall. Denn Träumen setzt voraus, dass Emotionen da sind, die die KI noch nicht hat. Außerdem fehlt die sogenannte Episodic Memory, das Erinnern an die eigenen Erfahrungen. Die KI weiß heute nicht mehr, was sie gestern Abend gemacht hat. Es gibt aber eine Ebene, die durchaus fähig ist, aus sich selbst heraus Neues zu schaffen: die sogenannten Hidden Layers. Sie entstehen, weil man die KI zwar trainieren kann, ihr aber nicht vorschreibt, was intern gelernt werden soll. Projekte wie etwa DeepDream von Google haben Daten aus diesen Hidden Layers genutzt, um Bilder zu erschaffen, die in dieser Zusammenstellung vorher nicht gelernt wurden. Sie erinnern vor allem durch die psychedelische Optik ans menschliche Träumen. So kann KI sicherlich spannendes Material erzeugen. Aber ist diese künstliche Kreativität ein Pendant zur Menschlichkeit? Ich denke nicht. Das Potenzial einer kreativen KI ist aber längst nicht ausgeschöpft."
Dr. Peter Spork ist Wissenschaftsautor und Biologe. In seinem Buch „Die Vermessung des Lebens“ widmet er sich den Potenzialen der Systembiologie und der Frage, wie sie die Medizin der Zukunft revolutionieren wird. Er erklärt, wie unser "digitaler Zwilling" die Zukunft vorhersagen kann und welche Fragen er uns beantwortet.
* "Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Navigationssystem für Ihre Gesundheit: Es berechnet, unter welchen Bedingungen Sie wann ans Ziel kommen. Das Leben ist natürlich viel komplexer als der Weg von A nach B, aber die Grundlage des digitalen Zwillings ist dieselbe. Er basiert auf Formeln und Algorithmen der Systembiologie. Dabei werden lebendige Prozesse berechnet, um vorherzusagen, wie sich das Leben in Zukunft weiterentwickeln könnte. Ich kann meinen digitalen Zwilling dann also fragen: Wie sieht mein Leben in zehn Jahren aus, wenn ich ab heute jeden Abend jogge? Oder wenn ich beschließe, ab jetzt jeden Abend zwei Bier zu trinken? Der Zwilling simuliert dann die Zukunft – und erhöht damit meine persönliche Freiheit, Bedingungen so zu definieren, dass ich das Leben führen kann, das ich führen möchte. Verbunden mit Datenmedizin wird die Systembiologie viele Aufgaben übernehmen, die Ärztinnen heute belasten. So kann sich die Medizin in Richtung Prävention bewegen, weg von der reinen Behandlung von Symptomen. Bis uns allen ein hochkomplexer, digitaler Avatar aus Formeln und Algorithmen zur Verfügung steht, liegt aber noch ein langer, kontinuierlicher Prozess vor uns. Expertinnen rechnen mit mindestens 30 Jahren. Trotzdem müssen wir jetzt die Weichen stellen, damit diese Vision eine positive bleibt – denn das Missbrauchspotenzial im Umgang mit den sensiblen Gesundheitsdaten ist hoch. Wenn wir also heute damit anfangen, verantwortungsvoll mit unseren Daten umzugehen, ist der digitale Zwilling eine echte Utopie."
Dr. Wolf Singer ist Hirnforscher und gehört zu den international führenden Neurowissenschaftlern. Er erforscht die komplexen Netzwerke, aus denen unser Gehirn aufgebaut ist und kann erklären, wie Kreativität im Gehirn entsteht.
Herr Dr. Singer, wie findet man Erfindungen?
* "Das menschliche Gehirn ist ein zweckorientiertes Organ. Sein Hauptnutzen besteht darin, Modelle der Welt zu erschaffen, die den Menschen für die Zukunft wappnen – denn wer schon einmal vorausgedacht hat, der kann im Notfall besser reagieren. Das funktioniert dank der Kommunikation zwischen Neuronen, die auch Ideen und sprachlich gefasste Gedanken ermöglichen. Welche Voraussetzungen benötigt das Gehirn nun, um kreativ zu sein? Kreativität ist dann gegeben, wenn neue Verbindungen zwischen Neuronen geschlossen werden. Das funktioniert über hochkomplexe Aktivitätsmuster, die permanent in diesem Netz aus Neuronen unterwegs sind. Irgendwann schlagen sie dann eine Brücke zwischen zwei Punkten, die davor nicht verbunden waren. So entsteht etwas Neues. Der kreative Akt, dieses ‚sich Gedanken machen‘, kann gefördert werden, indem man sich sehr intensiv mit einem Thema befasst und Pausen einlegt, um das Gehirn frei laufen zu lassen. Denn es arbeitet unterbewusst immer weiter. Wer also entsprechende Pausen macht, gibt dem Gehirn Raum für selbstorganisierte Prozesse. Der Grundstein dafür wird bereits in der frühkindlichen Entwicklung gelegt. Das menschliche Gehirn entwickelt sich etwa bis zum 20. Lebensjahr. Je früher man mit Prägungsprozessen beginnt, desto besser kann man sich später auf das Ausreifen dieser Verbindungen verlassen. Es ist wichtig, dem Gehirn früh genug Stoff zum Denken zu geben, damit es sich austoben kann."
Dr.-Ing. Bernhard Müller ist Sprecher der Fraunhofer-Gesellschaft für das Kompetenzfeld „Additive Fertigung“. Bei ihm in Dresden bündelt sich das Wissen zum Thema 3D-Druck aus 19 Instituten für angewandte Forschung in einer der führenden Forschungsgesellschaften der Welt. Wir haben ihn gefragt, ob der 3D-Druck uns ab jetzt alle Wünsche prompt und vor Ort erfüllt?
* "Beim 3D-Druck-Verfahren ist die Gestaltungsfreiheit riesig. Dadurch ist es möglich, auf ganz neue Art zu produzieren: Etwa nicht in Fabriken in Fernost, in denen große Mengen eines Produkts hergestellt und dann via Containerschiff über den Globus transportiert werden, sondern dort, wo das Produkt benötigt wird. Die Technik birgt großes Potenzial, um komplexe Produkte besser distribuieren zu können. In der Medizintechnik ist das in vielen Bereichen bereits angekommen. Allerdings reicht es nicht, einen Drucker in abgelegene Gebiete zu stellen und dann auf einen ‚Print‘-Knopf zu drücken, um ein hochkomplexes Produkt, wie zum Beispiel ein Implantat, zu drucken. 3D-Druck braucht handwerkliche Fähigkeit, Ingenieurskunst und Fachkenntnis. Wir sollten die Vorstellung relativieren, dass ein 3D-Drucker eine Art ‚Black Box‘ ist, die auf magische Art Produkte ‚zaubert‘. Im Endeffekt geschehen physikalische Vorgänge im Drucker, die hochkomplex sind und stetige Weiterentwicklung und Fachwissen benötigen – das läuft also ein bisschen anders als im Raumschiff Enterprise. Ob das Verfahren das Potenzial hat, Lebensverhältnisse zu verbessern? Ich denke ja, aber wir müssen davor noch einige Hürden nehmen. Die Forschung treibt gerade verschiedene Themen an, etwa die Ressourcen-Effizienz des 3D-Drucks oder die individuelle Anpassung von Produkten. Aktuell arbeiten wir auch an Innovationen wie etwa Smart Materials, also intelligenten Werkstoffen, die durch äußere Einflüsse Formveränderung ermöglichen. 3D-Druck ist eine Schlüsseltechnologie für diese programmierbaren Materialien. Da wird in den nächsten Jahren einiges passieren."
Wie funktioniert autonomes Fahren? Werden wir alle mit einem persönlichen K.I.T.T., dem sprechenden Fahrzeug aus der Serie „Knight Rider“, ausgestattet? Dr. Patrick Gebhard ist Leiter der Affective Computing Gruppe am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und erforscht Methoden um das Kommunizieren mit technischen Systemen sozialer zu gestalten.
Herr Dr. Gebhard, wissen Autos was Menschen denken?
* "Damit ein autonomes Fahrzeug in der Lage ist, Emotionen (im Sinne von subjektivem Erleben) zu simulieren und entsprechend zu interagieren, wird Affective Computing eingesetzt. Das sind emotionsbasierte KI-Methoden, die Computersysteme um Emotionen und soziales Verhalten ergänzen. Dadurch kann auf natürliche Art mit Assistenzsystemen interagiert werden. Erkenntnisse über die menschliche Psyche spielen dabei eine wichtige Rolle: In welcher Kultur ist man aufgewachsen, wie ist man sozialisiert, wie gestalten sich die individuellen Werte und Normen? Das Deuten von emotionalen Mustern im Gesicht oder in der Sprache allein reicht also nicht aus, um empathisch reagieren zu können. Außerdem müssen wir bedenken, dass ein großer Teil aller gezeigten Emotionen von Menschen reguliert wird. Wenn die KI-Methodik ausschließlich den regulierten Ausdruck aufgreift, kann das irreführend sein. Deshalb arbeiten wir daran, diese Regulierung in Computersysteme miteinzubeziehen. Ein autonomes Fahrzeug, das ohne derartiger Methoden arbeitet, ‚weiß‘ also nicht, was wir denken, es sieht bloß, was wir in unserem Gesicht zeigen. Darin liegt ein großer Unterschied. Wir arbeiten gerade daran, soziologische und psychologische Theorien auf interaktive Computermodelle zu übertragen; so können zukunftsorientierte autonome Systeme entstehen, die etwa in der Mobilität oder der Medizin große Vorteile mit sich bringen. Damit diese Systeme ihren Zweck erfüllen, muss man ihnen aber auch vertrauen können. Wir erforschen, wie man dieses Vertrauen erzeugen kann und wie der Roboter, in diesem Fall das Fahrzeug, agieren muss. Braucht das Assistenzsystem ein Gesicht? Begrüßt es die fahrende Person? Das alles hängt auch mit der individuellen Bindungsfähigkeit zusammen. Wir dürfen bei all der Vermenschlichung allerdings nicht vergessen, dass die Methoden der KI einen technologischen Ansatz darstellen. Diese Methodik kann kein ‚Wesen‘ bilden. Sie kann bestenfalls Erlebnisse und Empathie simulieren, wirklich erleben kann sie nichts."